Technologien in klinischen Studien: Die digitalisierte klinische Forschung
Erstellt am: 21.02.2021
Die Digitalisierung transformiert die klinische Forschung grundlegend. Dezentrale klinische Studien (DCTs) nutzen moderne Technologien, um digitale klinische Studien effizienter und patientenfreundlicher zu gestalten. Durch den Einsatz digitaler Tools wie Wearables, Patienten-Apps und elektronischer Datenerfassung lassen sich Daten präziser erheben und auswerten. Erfahren Sie mehr über die Chancen und Herausforderungen von DCTs in der klinischen Forschung.
Wearables: Digitale Datenquellen für dezentrale klinische Studien
Wearables spielen eine zentrale Rolle in digitalen klinischen Studien. Viele kennen sie als Fitnessarmbänder aus dem Alltag, dabei umfasst der Begriff eine Vielzahl an Messgeräten, die am Körper getragen werden können. Neben Mikrofonen und Bewegungssensoren ermöglichen auch integrierte Biosensoren eine kontinuierliche Erfassung wichtiger Gesundheitsdaten für klinische Studien.
Die Datenerhebung mithilfe von Wearables ist vielseitig:
-
Atemaktivitäten
-
Körpertemperatur
-
Herzfrequenz
-
Blutsauerstoffgehalt
-
Glukoselevel
Die nahtlose Integration dieser Daten in dezentralisierte klinische Studien ermöglicht eine präzisere Analyse der Arzneimittelwirkung. Je genauer die Datenerhebung durch Digitalisierung wird, desto vielfältiger gestalten sich die Optionen der Auswertung von klinischen Studien. Die neuen Technologien bieten innovative Lösungen für klassische Herausforderungen.
Verknüpft mit Smartphones oder Tablets, senden Wearables die gesammelten Daten unmittelbar an eine zentrale Studiendatenbank. Dadurch können Studienärzte frühzeitig auf Gesundheitsveränderungen reagieren und Patienten in digitalen klinischen Studien optimal betreuen. Zudem reduzieren Wearables signifikant den Bedarf an Vor-Ort-Besuchen und erleichtern die langfristige Patientenüberwachung.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Wearables in einer dezentralen klinischen Studie zum Einsatz kommen? Erfahren Sie hier mehr.
Patienten-Apps: Digitale Interaktion und Datenerhebung
Regelmäßige Gespräche zwischen Patienten und Ärzten sind ein essenzieller Bestandteil klinischer Studien. Dabei fragt der Mediziner den Gesundheitszustand oder die Medikamentenwirkung ab.
Die Digitalisierung verändert die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. In DCTs ermöglichen Apps eine ortsunabhängige Teilnahme an klinischen Studien, verbessern die Patientenbindung und revolutionieren somit die Kommunikation zwischen Patienten und Studienärzten. Über mobile Anwendungen können Patienten elektronische Fragebögen ausfüllen, Gesundheitsdaten dokumentieren und sich mit dem Studienteam austauschen. Wichtige Funktionen dieser Apps umfassen:
-
Elektronische Einwilligungserklärungen
-
Virtuelle Visiten per Videoanruf
-
Erinnerungen an die Einnahme von Arzneimitteln
-
Direkte Meldung unerwünschter Ereignisse
Diese digitalen Lösungen verbessern die Patientenadhärenz und steigern die Effizienz dezentralisierter klinischer Studien. Zudem reduzieren sie den Bedarf an Vor-Ort-Besuchen von Studienzentren, was insbesondere für Patienten in ländlichen Regionen von Vorteil ist. Die Kombination von Patienten-Apps mit anderen digitalen Technologien sorgt für eine nahtlose Erhebung und Verwaltung klinischer Daten.
White Paper
eCRF: Digitale Dokumentation in dezentralisierten klinischen Studien
Elektronische Case Report Forms (eCRFs) sind in digitalen klinischen Studien unverzichtbar. Diese web-basierten Dokumentationssysteme ersetzen traditionelle Papierformulare und ermöglichen eine strukturierte Erfassung klinischer Daten in Echtzeit. Neben Basis- und Anamnesedaten von Visiten dokumentieren Studienärzte unerwünschte Ereignisse gemäß dem Prüfplan. Je nach Projekt wird der Inhalt eines eCRFs jedoch individuell angepasst.
Zu den Vorteilen von eCRFs gehören:
-
Automatische Plausibilitätsprüfungen zur Fehlervermeidung
-
Direkte Speicherung in einer Datenbank und Überprüfung durch das Studienteam
-
Reduzierter administrativer Aufwand durch digitale Erfassung
-
Verbesserte Datenqualität und -sicherheit
Durch den Einsatz von eCRFs in dezentralen klinischen Studien sparen Studienärzte und Forscher wertvolle Zeit und verbessern gleichzeitig die Datenqualität erheblich. Automatische Plausibilitätsprüfungen reduzieren Fehler und minimieren den Nachbearbeitungsaufwand um etwa 80 Prozent. Gleichzeitig erleichtert die digitale Dokumentation die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und ermöglicht eine effiziente Analyse der gesammelten Daten. Auch aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit haben sich eCRFs in klinischen Studien durchgesetzt und sind mittlerweile ein fest etablierter Standard.
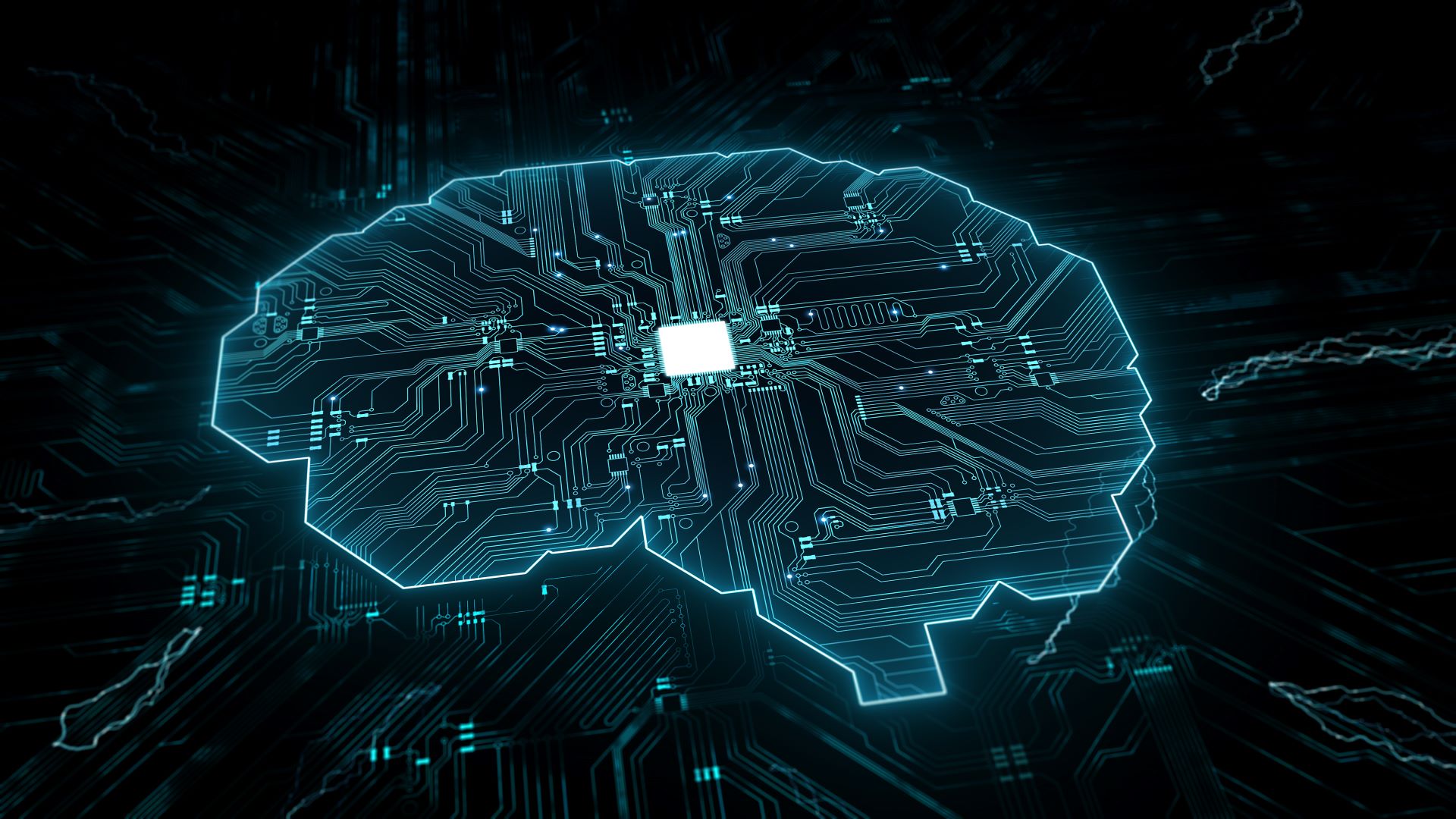
Künstliche Intelligenz: Effizienzsteigerung von digitalen klinischen Studien
Die Nutzung künstlicher Intelligenz revolutioniert die digitale klinische Forschung. Durch Machine Learning und automatisierte Algorithmen optimiert KI verschiedene Prozesse innerhalb von DCTs, darunter:
-
Identifikation und Rekrutierung geeigneter Patienten für Studien
-
Analyse großer Datenmengen in Echtzeit
-
Automatisierte Patientenkommunikation
-
Vorhersage von Studienergebnissen
Diese Technologien tragen dazu bei, die Datenintegrität zu erhöhen, Kosten zu senken und klinische Forschungsprozesse effizienter zu gestalten. Die Implementierung von KI in digitale klinische Studien unterstützt eine präzisere und schnellere Arzneimittelentwicklung. Darüber hinaus können durch KI-generierte Muster frühzeitig potenzielle Sicherheitsrisiken erkannt und behoben werden, was die Patienten- und Datensicherheit weiter verbessert.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind in den vergangenen Jahren immer mehr in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft angekommen. Lesen Sie hier, welche Chancen die Technologie bietet.
Regulatorische Anforderungen von DCTs
Um digitale klinische Studien erfolgreich durchführen zu können, müssen regulatorische Anforderungen eingehalten werden. Internationale und nationale Gesundheitsbehörden setzen Richtlinien fest, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und die Integrität der erhobenen Daten zu sichern. Zu den wichtigsten regulatorischen Anforderungen gehören:
-
Einhaltung der Richtlinien der Good Clinical Practice (GCP)
-
EU-Datenschutzvorgaben wie die DSGVO
-
Anforderungen der FDA und EMA für digitale Datenerfassung
Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Studienzentren, Sponsoren und Aufsichtsbehörden. Gleichzeitig müssen digitale Technologien kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den wachsenden Anforderungen in einer DCT gerecht zu werden.
Zukunftsperspektiven in der dezentralisierten klinischen Forschung
Die Zukunft der digitalen klinischen Studien wird von weiteren technologischen Fortschritten geprägt sein. Fortschrittliche Datenanalyse, Wearables, Patienten-Apps und der zunehmende Einsatz von Telemedizin sind nur einige der Entwicklungen, die die klinische Forschung weiter verändern werden. Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich frühzeitig auf diese Trends einstellen, können von effizienteren Prozessen und einer höheren Patientenbindung profitieren.
Wie sieht die Zukunft der klinischen Forschung aus? Drei Experten geben in diesem Blogartikel einen Ausblick.
Fazit
Dezentralisierte klinische Studien stellen einen Meilenstein in der modernen klinischen Forschung dar. Durch den Einsatz von digitalen Technologien wie Wearables, Patienten-Apps, eCRFs und künstlicher Intelligenz werden klinische Studien effizienter, patientenfreundlicher und datengetriebener. Gleichzeitig müssen regulatorische Vorgaben eingehalten und innovative Technologien weiterentwickelt werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser digitalen Lösungen wird die Zukunft der klinischen Forschung nachhaltig prägen und zu einer effizienteren Arzneimittelentwicklung beitragen.
„KI ist die Zukunft klinischer Studien“, sagt Jascha, Produktmanager Datenanalyse bei Alcedis. Lesen Sie hier das Interview mit ihm.

