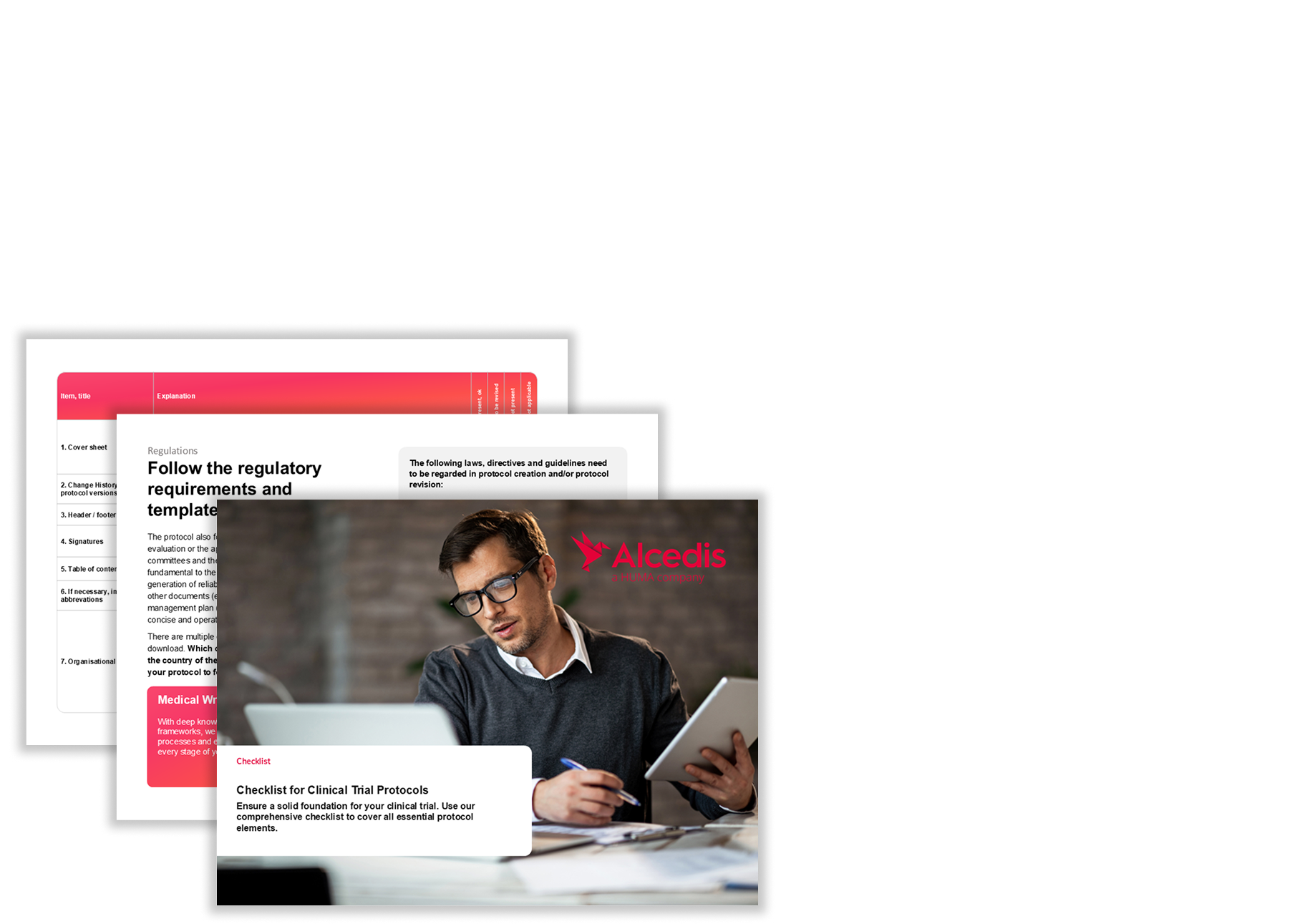So gelingt die Dezentralisierung klinischer Studien in drei Schritten
Erstellt am: 26.03.2024
Die dezentralisierte klinische Studie (DCT) bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere durch digitale Technologien, die eine remote Datenerhebung und flexible Durchführung ermöglichen. Dennoch bestehen häufig Vorbehalte hinsichtlich der Umsetzung, da Erfahrungen mit digitalen Lösungen fehlen oder Unsicherheiten bei Verantwortlichkeiten bestehen. Diese drei Schritte helfen, eine DCT effizient zu gestalten.
Was sind dezentralisierte klinische Studien?
Traditionell werden klinische Studien in stationären Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Universitätskliniken durchgeführt. Patienten müssen regelmäßig vor Ort erscheinen, um Daten zu liefern und Untersuchungen durchzuführen.
Die DCT revolutioniert diesen Prozess, indem sie digitale Technologien nutzt, um Daten ortsunabhängig zu erfassen. Dies geschieht durch:
-
Remote-Datenerhebung: Wearables wie Smartwatches oder Sleep-Tracker messen kontinuierlich relevante Vitalwerte.
-
Televisiten: Patienten und Prüferteams kommunizieren per Videotelefonie.
-
Digitale Fragebögen: Patienten beantworten Gesundheitsfragen online statt in persönlichen Befragungen.
-
Patientenportale: Hier können Teilnehmer Informationen abrufen und Daten austauschen.
-
Social-Media-Kanäle: Diese dienen dem Austausch zwischen Patienten.
Der digitale Ansatz stellt Patienten in den Mittelpunkt der klinischen Studie. Durch eine patientenzentrierte Durchführung werden Barrieren gesenkt und die Teilnahme erleichtert.
White Paper
Die Vorteile dezentralisierter klinischer Studien
Vollständig dezentralisierte klinische Studien sind selten, doch hybride Ansätze kombinieren traditionelle und digitale Verfahren erfolgreich. Diese ermöglichen:
-
Aussagekräftigere Daten: Echtzeitdaten aus kontinuierlicher remote Überwachung.
-
Erweiterte Patientenvielfalt: Ortsunabhängige Teilnahme erhöht die Diversität der Studienteilnehmer.
-
Bessere Patientenbindung: Eine flexiblere Durchführung reduziert Drop-outs.
-
Effizientere Prozesse: Digitale Lösungen optimieren Abläufe in klinischen Studien.
-
Kostensenkung und Zeitersparnis: Die digitale Umsetzung spart Ressourcen und beschleunigt die Markteinführung neuer Medikamente.
Schritt 1: Regularien und Technologien im Blick behalten
Der digitale Wandel eröffnet neue Möglichkeiten in der klinischen Forschung – stellt Studienverantwortliche jedoch auch vor komplexe Entscheidungen. Wer eine dezentralisierte Studie plant, sollte aktuelle regulatorische Rahmenbedingungen und technologische Entwicklungen kontinuierlich beobachten.
Denn sowohl gesetzliche Vorgaben als auch neue Tools können maßgeblich beeinflussen, ob ein DCT-Ansatz praktikabel und zulässig ist. Dabei lohnt sich ein strukturierter Überblick:
-
Welche Technologien – etwa eConsent, ePRO/eCOA, Televisiten oder Wearables – sind wissenschaftlich validiert und regulatorisch anerkannt?
-
Welche Anforderungen stellen Behörden wie EMA oder FDA an Datensicherheit, Transparenz und Patienteneinwilligung in digitalen Prozessen?
-
Welche digitalen Services können bestehende Abläufe konkret verbessern – z. B. durch Automatisierung, bessere Datenverfügbarkeit oder reduzierte Fehleranfälligkeit?
Eine Liste mit aktuellen Innovationen kann Projektleitern helfen, neue Strategien für ihre DCT zu entwickeln.
Schritt 2: Bedürfnisse aller Beteiligten einbeziehen
Eine erfolgreiche DCT setzt voraus, dass die Perspektiven aller Stakeholder berücksichtigt werden. Denn digitale Prozesse verändern nicht nur den Studienalltag, sondern auch die Rollen und Erwartungen aller Beteiligten – von Patienten über Prüfzentren bis zum Studienteam.
Ein frühzeitiger Dialog schafft Klarheit und Vertrauen:
-
Für Patienten: Wie komfortabel ist die Studienteilnahme von zuhause? Gibt es technische Hürden oder Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datenweitergabe?
-
Für Studienzentren und Prüfärzte: Wie verändern sich Arbeitsabläufe? Welcher Schulungs- und Betreuungsaufwand entsteht?
-
Für Sponsorenteams: Welche Prozesse lassen sich digitalisieren, ohne Qualität und regulatorische Anforderungen zu gefährden?
Eine bedarfsorientierte Planung, die auf Transparenz, Schulung und Support setzt, stärkt die Akzeptanz der digitalen Studienumgebung und ermöglicht einen reibungslosen Ablauf.
Schritt 3: Vertrauen in digitale Verfahren schaffen
Digitale Technologien funktionieren nur, wenn alle Beteiligten ihnen vertrauen. Studienverantwortliche stehen deshalb in der Pflicht, Unsicherheiten frühzeitig zu adressieren und gezielt entgegenzuwirken.
Dazu gehören:
-
Nutzerzentrierte Schulungen für Patienten, Studienpersonal und Prüfärzte, die konkrete Anwendungsszenarien vermitteln und Berührungsängste abbauen.
-
Transparente Kommunikation zu Datenschutz, Datenverwendung und Verantwortlichkeiten – etwa durch verständlich aufbereitete Informationsmaterialien oder FAQs.
-
Feedbackmechanismen, um Rückmeldungen systematisch zu erfassen, zu analysieren und in die Weiterentwicklung der digitalen Prozesse einfließen zu lassen.
So entsteht eine vertrauensvolle Studienumgebung, in der alle Beteiligten sicher mit digitalen Tools arbeiten und deren Potenziale bestmöglich nutzen können.
Herausforderung Interoperabilität: Einheitliche Datenformate sicherstellen
Ein zentrales Problem in der digitalen Durchführung klinischer Studien ist die Verarbeitung verschiedener Datenformate. Unterschiedliche Technologien und digitale Services generieren Daten in heterogenen Strukturen, was die Analyse erschwert.
Die Lösung: Ein klinisches Datenmanagementsystem, das alle Informationen in einem standardisierten Format zusammenführt. Dadurch werden Daten in Echtzeit abrufbar, synchronisiert und effizient ausgewertet.
Fazit: Dezentralisierte klinische Studien als Zukunft der Forschung
Die Implementierung einer DCT erfordert eine gezielte Strategie, um regulatorische, technologische und organisatorische Herausforderungen zu meistern. Durch einen strukturierten Ansatz profitieren alle Beteiligten von einer flexibleren, effizienteren und patientenfreundlicheren klinischen Forschung.
Digitale Technologien ermöglichen eine moderne Durchführung klinischer Studien, die die Qualität der erhobenen Daten steigert und den Forschungsprozess optimiert. Unternehmen, die auf den DCT-Ansatz setzen, sichern sich einen Innovationsvorsprung in der klinischen Forschung.