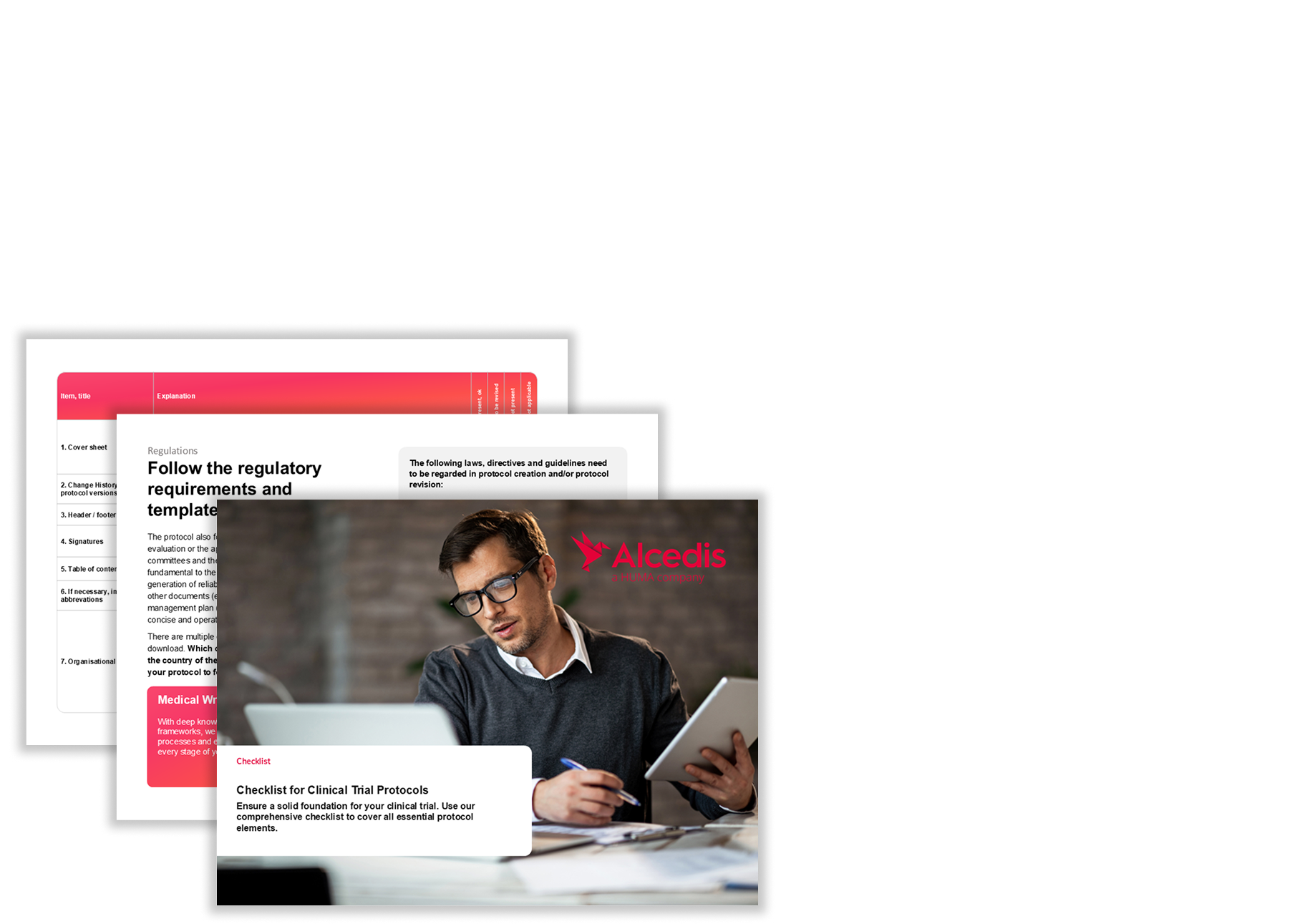Hindernisse auf dem Weg zur Digitalisierung klinischen Monitorings
Erstellt am: 16.04.2024
Klinische Monitore arbeiten die meiste Zeit in Studienzentren. Doch vor allem der erste Lockdown während der Corona-Pandemie beeinflusste ihre Arbeitsweise und warf eine Frage auf: Sollte der Beruf der klinischen Monitore digitalisiert und somit ortsunabhängiger werden?
Was sind die Aufgaben klinischer Monitore?
Klinische Monitore oder Clinical Research Associates (CRAs) leisten einen entscheidenden Beitrag in klinischen Studien. Sie sorgen während einer Studie für die Einhaltung des Prüfplans, der Guten Klinischen Praxis (GCP) und der gesetzlichen Bestimmungen im Umgang mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. Dafür überprüfen sie vor Ort in den Studienzentren Quelldokumente wie Patientenakten oder Protokolle. Dieser sogenannte Quelldatenabgleich wahrt die Patientensicherheit und Datenintegrität.
Darüber hinaus analysieren sie kontinuierlich die erhobenen Daten, um frühzeitig auf Auffälligkeiten oder Risiken im Studienverlauf reagieren zu können. Eine strukturierte Dokumentation und Archivierung dieser Daten trägt wesentlich zur Nachvollziehbarkeit und Qualität der klinischen Studie bei.
CRAs sind außerdem das Bindeglied zwischen Prüfzentren und Sponsoren oder Auftragsforschungsinstituten (CROs). So besteht ein Großteil ihrer Tätigkeit sowohl in der Berichterstattung an die Projektleiter als auch in der Aufklärung von Prüfärztinnen und Prüfärzten über deren Aufgaben während der klinischen Studie. Daher müssen CRAs genau mit dem Studienprojekt vertraut sein, Gesetze sowie Regularien kennen und ein medizinisches Grundverständnis besitzen, um alle Vorgänge nachvollziehbar zu erklären.
Regelmäßiger Kontakt mit allen beteiligten Partnern – vom Sponsor über das CRO bis zum Studienarzt – ist dabei essenziell für den Studienerfolg. Gerade in komplexen Studien ist ein reibungsloser Kontakt zwischen allen Beteiligten entscheidend für ein gutes Management.
White Paper
Wie die Pandemie das Monitoring in klinischen Studien beeinflusst hat
Die Corona-Pandemie beeinflusste die Arbeitssituation vieler klinischer Monitore. Unzählige Studienzentren schlossen während des ersten Lockdowns, Vor-Ort-Besuche wurden abgesagt und klinische Studien dadurch verlängert oder gar gestoppt. Diese Veränderung brachte für viele CRAs, die freiberuflich arbeiten, eine berufliche Unsicherheit. So entschieden sich einige in der Pandemie eine Festanstellung, etwa bei Pharmaunternehmen, anzunehmen.
Auch das Management laufender Studienprojekte war durch die neuen Bedingungen herausgefordert. Viele Teams mussten kurzfristig auf neue Prozesse und Technologien umsteigen, um die Studien fortsetzen zu können.
Die Pandemie stellte zudem die Branche vor Herausforderungen: Wie sollten klinische Studien während des Lockdowns durchgeführt und gleichzeitig die Patientensicherheit sowie Datenintegrität gewahrt werden? Als Reaktion darauf veröffentlichten das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ergänzende Empfehlungen zu der von der Europäischen Union veröffentlichten Handlungsempfehlung zur Durchführung klinischer Studien in Zeiten des Coronavirus („Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) Pandemic“)1.
Für den Quelldatenabgleich schlugen sie folgende Maßnahmen vor:
-
Absage oder Verschieben von bereits geplanten Monitoring-Besuchen
-
Verlängerung der Intervalle zwischen den Vor-Ort-Besuchen
-
Wechsel zu Prüfzentren, die nicht oder weniger durch die Pandemie belastet sind
-
Bereitstellung von Kopien der Quelldokumente für die Monitore durch die Prüfzentren, personenidentifizierende Informationen der Patienten sind unkenntlich gemacht
-
Direkter und kontrollierter Fernzugriff für Monitore auf Verwaltungssysteme der Quelldaten
-
Passiver Zugang für Monitore zu Quelldaten durch Live-Bildübertragung mit dem Zentrum
Remote Monitoring in klinischen Studien: Vorteile und digitale Lösungen
Remote Monitoring bezieht sich auf den Prozess der Überwachung und Überprüfung von Studiendaten sowie anderer relevanter Studienaktivitäten aus der Ferne. Elektronische Systeme und Technologien ermöglichen den CRAs den Quelldatenabgleich, oder source data verification (SDV) und source data reviews (SDR), aus der Ferne durchzuführen – SDV und SDR werden zu rSDV und rSDR (r = remote).
Ein entscheidender Vorteil des Remote Monitorings liegt in der verbesserten Sicherheit der Übertragungsprozesse durch moderne Verschlüsselungs- und Zugriffstechnologien. Zugleich verbessert es die Unterstützung für Prüfzentren, die schneller auf Rückfragen reagieren und Korrekturen umsetzen können.
Dieser Ansatz nutzt verschiedene digitale Werkzeuge und Plattformen, um den Zugriff auf Studiendaten zu erleichtern und eine effiziente Überprüfung von Quelldaten, Protokoll-Compliance und anderen Studienaktivitäten zu ermöglichen. Dazu gehören webbasierte Studienmanagement-Systeme, elektronische Studiendokumente und Kommunikationsplattformen für den Austausch von Informationen mit Studienzentren.
Gute digitale Lösungen setzen dabei auf benutzerfreundliche Interfaces und auf die gezielte Unterstützung der Nutzer durch Schulungsangebote und technischen Support. Dadurch kann die Qualität der Datenerhebung und -überprüfung auch im digitalen Umfeld sichergestellt werden.
Vor welchen Hindernissen steht die Digitalisierung des klinischen Monitorings?
Die Corona-Pandemie wies für das klinische Monitoring eindeutig die Grenzen der bestehenden Strukturen und der bisherigen Digitalisierung auf. Viele empfanden dies als “Wake-up Call” und Chance für die klinische Forschung.
Starke Veränderungen im klinischen Monitoring bleiben dennoch aus. Die sich stetig digitalisierenden Quelldaten bieten zwar eine Voraussetzung für rSDV, allerdings wird aufgrund uneinheitlicher oder gar fehlender Gesetzesvorgaben die Genehmigung eines rSDV-Verfahrens und dessen Etablierung nahezu unmöglich. Dies zeigte sich auch während der Pandemie:
-
Der Fernzugriff auf Quelldokumente sollte nur in begründeten Ausnahmefällen und nur in zwingend erforderlichem Umfang erfolgen.
-
Nur die entscheidendsten Informationen wurden digital überprüft. Außerdem können anonymisierte oder pseudonymisierte Dokumente nicht als Quelldokumente angesehen werden. Dokumente, die einer Fernüberprüfung unterzogen wurden, mussten oft erneut vor Ort überprüft werden.
-
In den meisten Fällen blieb es bei Vor-Ort-Besuchen in einer sicheren Arbeitsumgebung, da nach dem ersten Lockdown aufgrund von Abstands- und Hygieneregelungen mehr Sicherheit im Umgang mit dem Coronavirus herrschte.
Hinzu kommt, dass in vielen Studienzentren die technische Infrastruktur fehlt, die etwa einen Schutz vor unbefugten Zugriff durch Dritte gewährleisten würde. Und selbst in den Zentren, in denen sie existiert, mangelt es ebenso oft an Erfahrung im Umgang mit Remote Monitoring, sodass Einarbeitungen und Fehler in den ersten Projekten anfangs zu einem höheren Zeit- und Kostenaufwand führen können. Insbesondere für kleinere Teams ist eine umfassende Vorbereitung und Schulung notwendig, um ein sicheres und zuverlässiges digitales Arbeiten zu ermöglichen.
Um Verantwortlichkeiten zu klären, Arbeitsprozesse zu verfeinern und Gesetze sowie Regularien auszuarbeiten, braucht es mehrere Jahre praktischer Anwendung und Erfahrung. Für ein Remote Monitoring auf internationaler Ebene müssten außerdem harmonisierte Sicherheits- und Vertraulichkeitsstandards zwischen den Datenschutzbehörden der verschiedenen Länder aufgestellt werden.
Digitales Monitoring klinischer Studien – sinnvoll oder nicht?
Viele zweifeln an, ob die Arbeit klinischer Monitore digitalisiert werden sollte. Diese Punkte sprechen gegen ein digitales klinisches Monitoring:
-
Schulung und Coaching des Prüferteams fällt vielen vor Ort und im persönlichen Kontakt leichter
-
Studienzentren sind oft in mehrere Projekte zugleich involviert, die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung vor Ort gibt beiden Seiten mehr Sicherheit
-
Geringe Erfahrung mit digitalen Technologien macht zusätzliche Schulungen für das Prüferteam vor Ort notwendig
Umgekehrt gilt aber: Hat das Studienzentrum bereits Erfahrung und die nötige Infrastruktur, böten sich unter anderem Videotelefonate für digitale Initiierungsbesuche oder Coaching des Prüferteams aus der Ferne an.
Aufgrund der Individualität jeder Studie gilt es, in den verschiedenen Projekten die Balance zwischen Remote und Vor-Ort-Monitoring zu finden. Das Monitoring-Konzept wird nach dem Risikoprofil einer klinischen Studie festgelegt. Ein digitaler Ansatz im klinischen Monitoring sollte nur verfolgt werden, wenn ein angemessener Schutz sensibler Patientendaten gewährleistet ist und der Nutzen jegliche Risiken rechtfertigt. Meist ist jedoch ein risk-based Clinical Monitoring, das in der Durchführung Vor-Ort und remote Ansätze kombiniert, effizienter als ein reines Vor-Ort-Konzept.
Doch welche Methode der Sponsor auch wählt, wichtig bleibt vor allem: Für ein effizientes klinisches Monitoring sollte die Strategie ausführlich und nachvollziehbar im Prüf- und Monitoring-Plan beschrieben werden. Die Methoden, verwendete Technologien und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten sollten sowohl für die zuständigen Behörden und Kommissionen als auch für das Prüferteam und die CRAs verständlich sein.
1https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Klinische-Pruefung/KPs_bei_COVID-19.html