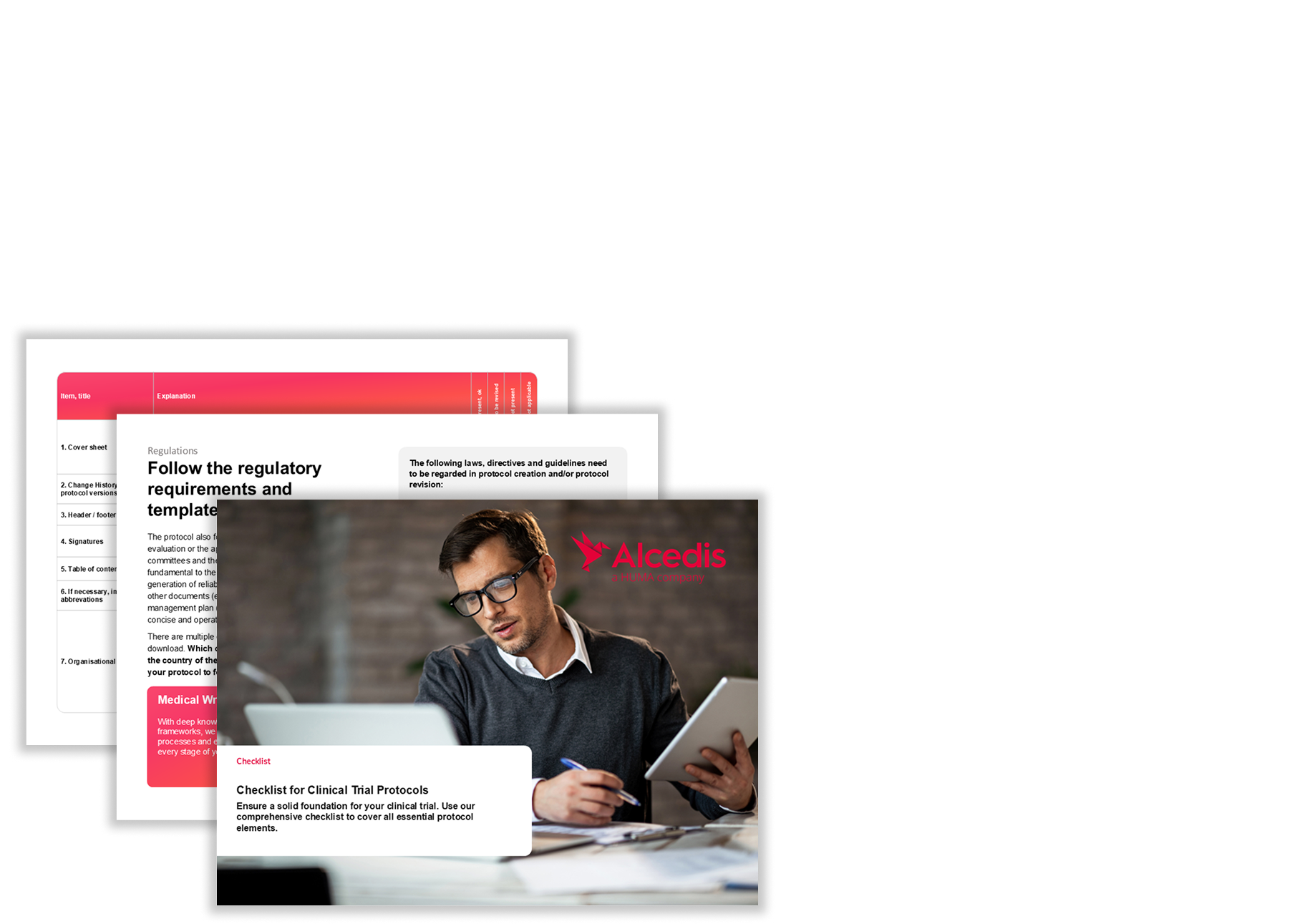Mobile Geräte in klinischen Studien: Welche Chancen die Digitalisierung bietet
Erstellt am: 26.05.2021
In dezentralisierten klinischen Studien (DCTs) ermöglichen mobile Technologien eine effizientere Datenerhebung, eine engere Einbindung der Teilnehmer und eine dezentrale Durchführung. Doch welche Chancen bietet dieser digitale Ansatz, und welche Herausforderungen müssen bewältigt werden? Ein Überblick.
Smartphones, Tablets, Wearables – mobile Geräte sind aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Ob auf Reisen, beim Sport, Zuhause oder im Büro, sie prägen die Kommunikation der Menschen. Der digitale Fortschritt erleichtert den Alltag. Handel und Industrie nutzen neue Technologien, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Auch in klinischen Studien wird der Einsatz von digitalen Geräten und Apps für Patienten immer weiter vorangetrieben.
DCTs und die Digitalisierung klinischer Studien
Der digitale Wandel verändert klinische Studien grundlegend. DCTs setzen verstärkt auf digitale Lösungen, um Patientinnen und Patienten ortsunabhängig in den Forschungsprozess einzubinden. Besonders mobile Geräte und Apps spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie erleichtern nicht nur die Datenerhebung, sondern verbessern auch die Transparenz für die Teilnehmer.
Dezentrale klinische Studien ermöglichen es Patienten, ihre Gesundheitsdaten direkt über eine App zu erfassen und an das Forschungsteam zu übermitteln. Dadurch erhalten sie nicht nur mehr Einblick in den eigenen Krankheitsverlauf, sondern können auch aktiv am Forschungsprozess teilnehmen. Der digitale Ansatz erleichtert zudem die Kommunikation zwischen Studienzentren und Patienten, was die Patientenbindung stärkt.
White Paper
Mobile Technologien und die Datenerhebung in DCTs
Der Einsatz von Wearables und anderen mobilen Technologien verbessert die Datenerhebung in digitalen klinischen Studien erheblich. Automatisierte Messungen reduzieren Fehlerquellen und liefern kontinuierlich präzise Daten. Beispiele für digitale Lösungen sind:
-
Smartwatches und Fitnesstracker: Erfassen Aktivitätslevel, Pulsfrequenz und Schlafmuster.
-
Sensoren zur Gesundheitsüberwachung: Messen Hautleitfähigkeit, Blutzucker oder Sauerstoffsättigung.
-
Apps zur Symptomerfassung: Teilnehmer können Beschwerden oder Medikationsänderungen direkt dokumentieren.
Diese digitalen Methoden ermöglichen eine kontinuierliche Datenerhebung, ohne dass Teilnehmer aktiv Werte notieren müssen. In dezentralen klinischen Studien ist dies besonders wertvoll, da Echtzeitdaten eine genauere Analyse des Krankheitsverlaufs ermöglichen.
Digitale klinische Studien auch für ältere Generationen
Ein häufiges Vorurteil gegenüber digitalen klinischen Studien ist, dass ältere Teilnehmer möglicherweise Schwierigkeiten mit neuen Technologien haben. Laut dem Statistischen Bundesamt nutzen jedoch 85 Prozent der über 60-Jährigen ihr Smartphone bis zu 60 Minuten am Tag. Dieses Verhalten bietet eine Chance, um relevante Daten für klinische Studien zu erfassen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Eingabe schnell, unkompliziert und intuitiv funktioniert.
Ein bewährter DCT-Ansatz ist „Bring Your Own Device“ (BYOD), bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Geräte für die Dateneingabe nutzen. Dies reduziert die Hemmschwelle und erhöht die Akzeptanz digitaler klinischer Studien. Eine intuitive Bedienung und klare Anleitungen sind dabei entscheidend, um eine barrierefreie Teilnahme für alle Altersgruppen zu gewährleisten.
Mehr zum Thema Senioren in digitalen Studien erfahren Sie hier.
Datenschutz und Sicherheit in digitalen klinischen Studien
Ein wesentlicher Aspekt bei der Digitalisierung klinischer Forschung ist der Schutz sensibler Gesundheitsdaten. Dezentrale klinische Studien setzen daher auf hohe Sicherheitsstandards:
-
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die übermittelten Daten.
-
Pseudonymisierung stellt sicher, dass persönliche Informationen anonym bleiben.
-
Regelmäßige Sicherheitsprüfungen gewährleisten die Einhaltung höchster Datenschutzrichtlinien.
Vor Studienbeginn werden Teilnehmer ausführlich und detailliert über den Umgang mit ihren Daten informiert. Diese Transparenz stärkt das Vertrauen in digitale klinische Studien und erhöht die Bereitschaft zur Teilnahme an DCTs.

Digitalisierung klinischer Studien bietet Chancen für alle
Die Chancen der mobilen Datenerhebung sind zahlreich: Echtzeit-Auswertungen ermöglichen einen präzisen Überblick über den Studienverlauf, während eine zunehmende Anzahl an Datenquellen die wissenschaftliche Aussagekraft stärkt.
Durch den Einsatz von Apps und Wearables können Teilnehmer einfacher in den Studienprozess eingebunden werden, erhalten regelmäßige Updates und Erinnerungen und können ihren Gesundheitsstatus bequem dokumentieren. Dies reduziert Abbruchraten und erhöht die Datenqualität, was wiederum zu zuverlässigeren und aussagekräftigeren Ergebnissen führt.
Gleichzeitig erfordert diese Methode eine sorgfältige Qualitätskontrolle. Um fehlerhafte Daten oder falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden, müssen die erfassten Informationen regelmäßig überprüft werden.
Herausforderungen digitaler klinischer Studien
Trotz der vielen Vorteile gibt es Anforderungen, die bei der Umsetzung von DCTs berücksichtigt werden müssen:
-
Technische Barrieren: Nicht alle Patienten sind mit digitalen Lösungen vertraut. Eine einfache und nutzerfreundliche Gestaltung ist essenziell.
-
Datenvalidität: Automatisch erhobene Daten müssen regelmäßig überprüft werden, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.
-
Anpassung für medizinisches Fachpersonal: Auch Ärzte und Forscher müssen in den Umgang mit digitalen klinischen Studien geschult werden.
Fazit: Digitale klinische Studien als Zukunftsmodell
Die Integration mobiler Technologien in klinische Studien bringt zahlreiche Vorteile mit sich. DCTs ermöglichen eine flexiblere, effizientere und patientenfreundlichere Forschung. Die digitale Erhebung von Daten verbessert nicht nur die Qualität der Studien, sondern stärkt auch die Patientenbindung.
Während Herausforderungen wie Datenschutz und technische Hürden nicht unterschätzt werden dürfen, zeigt sich: Digitale klinische Studien sind ein entscheidender Schritt in die Zukunft der medizinischen Forschung. Durch innovative digitale Lösungen können DCTs den Studienprozess optimieren und die Teilnahme für alle Beteiligten erleichtern.
Neben den Patienten profitieren auch Ärzte und Forscher von digitalen Lösungen, sofern diese den medizinischen Alltag erleichtern, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen. Entscheidend ist, dass Technologien so gestaltet sind, dass sie intuitiv und effizient nutzbar sind. Das übergeordnete Ziel bleibt: Die Digitalisierung klinischer Studien soll allen Beteiligten zugutekommen – von den Teilnehmern über die medizinischen Fachkräfte bis hin zur klinischen Forschung selbst.
Erfahren Sie hier mehr über die Vision und Technologien von Alcedis Platforms für Ihr nächstes Studienvorhaben.