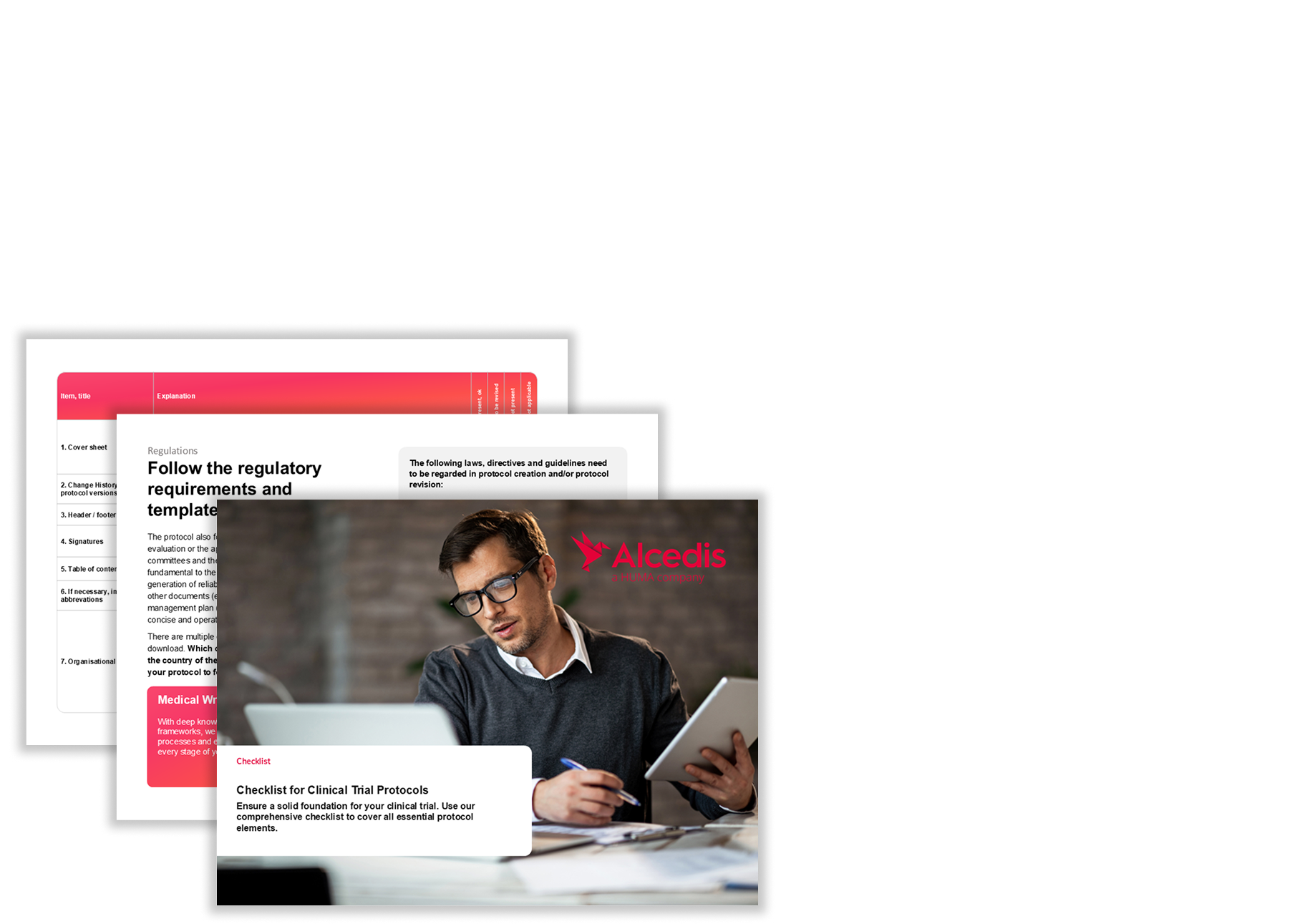Interview mit Viktor Grünwald: "Ich wünsche mir, dass mehr auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten eingegangen wird"
Erstellt am: 31.10.2022
Klinische Studien werden digitaler, Patientinnen und Patienten vernetzter - was bedeutet das für die Forschung? Viktor Grünwald, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum Essen, spricht im Interview über die Herausforderung der Koordinierung klinischer Studien, warum die Corona-Pandemie eine verpasste Chance für das Remote Monitoring ist und warum die Automatisierung von Prozessen die Forschungslandschaft weiter prägen wird.
Prof. Grünwald, das digitale Zeitalter prägt auch die Wissenschaft und den Betrieb in Kliniken. Vor welche Herausforderungen stehen klinische Studien heute?
Vor allem die Koordination von klinischen Studien wird immer komplexer. Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten der Datenerhebung, etwa über den eCRF, den digitalen Prüfbogen. Doch damit kommen neue Anforderungen auf Studienteams zu. Oft dokumentieren wir doppelt – auf Papier und im eCRF. Diese zweifache Dateneingabe bindet viel Zeit und die Ressourcen meines Teams. Daher plädiere ich von der Anwenderseite dafür, sich für einen Weg zu entscheiden und digitale Standards zu entwickeln, die für alle Studien gelten. Uns würde beispielsweise ein Portal helfen, indem man sich einmalig anmeldet und von dort die Dateneingabe für verschiedene Studien pflegen kann. Entscheidend ist hierbei die Funktionalität, die aktuelle Entwicklungen noch vermissen lassen. Ähnlich verhält es sich mit den Feasibility-Fragebögen der Ethikkommissionen, auch hier wünsche ich mir einen einheitlichen Standard, der das Ausfüllen beschleunigt und nicht immer wiederkehrende, gleichförmige Eingaben notwendig macht. Allein die Definition und spätere Auswertung der Einschluss- und Ausschlusskriterien schafft viel Raum für Diskussionen und bindet für mich und mein Team enorm viel Zeit. Darüber hinaus plädiere ich für Inspekteure mit medizinischer Fachexpertise. Der Medizinbetrieb akzeptiert einfach andere Standardabweichungen und Normen, als die die wir aus der Industrie kennen. Die Patientenversorgung ist bedarfsgerecht und berücksichtigt individuelle Faktoren. Diese Flexibilität müssen wir in Protokollen abbilden können, um eine exzellente Versorgung anbieten zu können.
Neues Whitepaper
Inwiefern hat die Corona-Pandemie die Grenzen der Digitalisierung aufgezeigt?
Die Pandemie ist eine verpasste Chance für das Remote Monitoring, der externen digitalen Datenüberprüfung. Natürlich haben einige Forschungsinstitute im Zuge der Kontaktbeschränkungen Remote Monitoring ausprobiert. Viele aber haben Studien in der ersten Phase der Pandemie auch gestoppt. Das Problem: Es fehlen einheitliche Vorgaben, die eine Einführung und Etablierung erleichtern würden. Tatsächlich macht es keinen Unterschied, ob ein klinischer Monitor, die Daten vor Ort, also an einem Computer in unserer Klinik, sichtet, oder über einen digitalen Zugang von überall auf der Welt. Nutzen wir eine sicherere Verschlüsselung, muss sich niemand wegen der Daten sorgen. Wenn wir vermehrt auf Remote Monitoring setzen würden, könnten wir Ressourcen sparen, etwa die Verkürzung von zeitlichen Abläufen, die durch das Reisen entstehen - und so schnellere Ergebnisse erzielen.
Neue Innovationen prägen die klinische Forschung. Wie wird sich die Studienlandschaft in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Lesen Sie hier einen Ausblick von drei Expertinnen und Experten.
Patienten rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Wie müssen sich Studien auf sie einstellen?
Klinische Studien stellen den Patienten in den Mittelpunkt, es geht um das Wohl der Betroffenen. Ich wünsche mir, dass mehr auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten eingegangen wird. Es gibt beispielsweise Studien, in denen diese sich alle sechs Wochen einer CT-Untersuchung unterziehen müssen – ohne, dass ein Ende vorgesehen ist. Ich finde diese Studiendesigns gehen am Bedarf von Patient:innen vorbei. Eine engmaschige Betreuung für ein halbes Jahr mit anschließenden Routineuntersuchungen im Dreimonatstakt ergeben für mich mehr Sinn. Sobald Patientinnen und Patienten stabile Werte aufweisen, sollte man die Zahl der Untersuchungen herunterfahren. Zudem müssen wir in der Aufklärung mehr auf den Patienten eingehen. Es braucht kein Pamphlet, das auf mehr als 30 Seiten jedes Detail aufzeigt. Vielmehr sollten wir verstärkt das Patientengespräch zur Aufklärung nutzen und uns bei den Informationen auf das Wesentliche fokussieren.
Welche Punkte wären das?
Den Patientinnen und Patienten muss klar die Behandlungssituation aufgezeigt werden, sie sollen verstehen, was in den nächsten Monaten oder gar Jahren auf sie zukommt. Dazu gehört auch der Aufwand der Betroffenen. Sie sollten wissen, was von ihnen erwartet wird, wie viel Zeit sie etwa für Visiten einplanen müssen. Zudem sollte über das Ziel der Studie informiert werden: welche Ergebnisse werden erwartet, was erhofft man sich? Auch Nebenwirkungen spielen dabei eine Rolle. Hier sollten Ärztinnen und Ärzte aber nicht jede kleinste Eventualität von unerwünschten Wirkungen aufzeigen, sondern mehr auf relevante Einschränkungen im Alltag eingehen. Viele Patientinnen und Patienten sind gut informiert, sie wissen oft schon vorher, worauf sie sich einlassen. Auch die Wahrnehmung von Studien hat sich verändert. Menschen setzen in sie heute mehr Vertrauen, sehen eine Teilnahme eher als Chance anstatt als Belastung.
Lesen Sie hier ein Interview mit Prof. Vogel-Claussen über die HANSE-Studie, die Rauchern und ehemaligen Rauchern die Möglichkeit bietet, an einer kostenlosen Lungenkrebs-Früherkennung teilzunehmen.
Was bräuchte es von Seiten des Gesetzgebers, um die klinische Forschung in Deutschland voranzutreiben?
Besonders die verschiedenen Bewertungen der deutschen Ethikkommissionen erschweren Deutschlands Rolle im internationalen Vergleich. Das Beratungsverfahren für Studien unterscheidet sich von Kommission zu Kommission und ist nur schwer kalkulierbar. Manche Sponsoren entscheiden sich deshalb für andere Studienzentren im Ausland, weil das Verfahren dort unkomplizierter abläuft. Ich wünsche mir einheitliche Standards der Begutachtung und hoffe, dass das neue Genehmigungsverfahren der EU eine Veränderung bringt. Für Studien innerhalb Europas reicht dann ein Antrag aus, über den Behörden und Ethikkommissionen gemeinsam entscheiden. Es braucht nicht mehr für jedes Land eine eigene Prüfung. Das erhöht die internationale Wettbewerbsfähigkeit, zugleich vereinfacht und beschleunigt es die Verfahren.
Studien werden digitaler, Menschen vernetzter. Welche Anforderungen kommen auf die klinische Forschung zu?
Der Prozess der Dateneingabe muss weiter vereinfacht werden. Im digitalen Zeitalter benötigen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer klinischer Forschung Strukturen für einen automatisierten Datenexport. Immer noch kommt es auf das Auftragsforschungsinstitut oder das Studienzentrum an, wie digitalisiert eine Studie abläuft. Zudem müssen wir Rückfragen kleinhalten, besser definieren, welche wirklich notwendig sind. Aktuell sind wir mit unzähligen Queries konfrontiert, deren Bearbeitung nicht immer zielführend sind. Wir sollten mehr Zeit in die Versorgungsforschung investieren und Alltagsdaten generieren. Diese könnten wir für weiter Studien nutzen, um deren Fragestellungen in kürzerer Zeit zu beantworten. Davon profitieren nicht nur Studienstandorte, sondern auch Patientinnen und Patienten.
Klinische Studien sind zeit- und kostenintensiv. Erfahren Sie hier mehr über digitale Innovationen, die eine echte Chance für die Zukunft sind.
Schauen wir einmal in die Zukunft: Wie wird die klinische Forschung in zehn Jahren aussehen?
Die Automatisierung von Prozessen wird die Forschungslandschaft weiter prägen. Bereits jetzt gibt es universitäre Kollektive oder digitale CROs, die versuchen, die Dateneingabe zu verbessern. Ein Beispiel hierfür ist der Ansatz, Patienten mehr in die Eingabe ihrer Werte zu involvieren. Studienteilnehmende können ihre Informationen über Wearables selbst zur Verfügung stellen, dies gilt es, weiter zu fördern. Hier sollten Forschende aber Fehlereintragungen kalkulieren und sich gut überlegen, wie viel Unschärfe ihre Studienergebnisse vertragen. Klar ist aber: Das Nutzen dieser Schwarmintelligenz lässt uns flexibler agieren, beschleunigt Abläufe und spart Kosten.